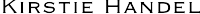Der siebte Sinn (7. September 2025)

Der siebte Sinn
SEHEN
Ich SEHE immer mal wieder Einladungen zu Clownworkshops, wo es darum geht, die Kunst des Scheiterns zu erlernen. Und oft denke ich mir dann, wie wenig eigentlich über das Scheitern geschrieben wird – über das echte Scheitern, nicht das gespielte Scheitern auf der Bühne.
HÖREN
Dabei gibt es nichts Lustigeres oder Spannenderes als bei Festivals oder auf Autofahrten mit Kolleginnen und Kollegen über Auftritte zu sprechen, bei denen man gnadenlos gescheitert ist. Man HÖRT gespannt zu, fühlt mit und lacht oft am meisten über das, was misslungen oder völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
Ich mag daran besonders, dass in solchen Gesprächen jegliche Eitelkeit von Bühnenkünstlern verschwindet und die Zerbrechlichkeit der Arbeit bewusst wird. Zugleich ist die Person, die über ihr persönliches Scheitern spricht, während der Erzählung peinlich berührt, so dass sich dieses Gefühl auf einen selbst überträgt und die Geschichte spannend macht. Scheitern ist eben verdammt menschlich. Alle scheitern, wenige geben es zu. Viele behalten es für sich. Ihr kleines Geheimnis des Scheiterns. Wenn es jedoch verraten wird, verwandelt sich das Scheitern in eine lustige Geschichte, die zum Leben gehört, und alles ist halb so schlimm.
Es geht zum Beispiel um Auftritte, die nie gespielt wurden, weil zwei Orte gleich hießen und ein Kollege (damals ohne Navi) am falschen Ort war. Es geht um gnadenlos ehrliche Kinderkommentare über muffelige, schweißtreibende Kostüme: „Bäh, der Bär stinkt!“, was in dem Moment fast so viel Wirkung beim Publikum hat wie „Der Kaiser ist nackt!“ Es geht um Momente der Panik bei der Feststellung eines vergessenen wichtigen Requisits kurz vorm Auftritt und die alberne Alternativlösung, die einem aus der blanken Not heraus einfällt, und bei der Erinnerung daran muss man kichern, weil es so peinlich ist. Und es geht darum, welche Überraschungen das Auftrittsleben noch so bereit hält.
TASTEN
Einer meiner schlimmsten Auftritte war ein Wettbewerb. Nicht der Auftritt selbst, aber das was hinterher passierte. Es war in der Zeit, als ich noch etwa gleich oft für Erwachsene und Kinder spielt und nicht wie aktuell mehr für Familien und Kinder. Ich war in meinen beruflichen Anfängen und TASTETE mich langsam an eigene Stücke heran. Ich wurde zu drei Wettbewerben eingeladen. Nach Passau zum „Jugend kulturell Förderpreis“ von der Hypovereinsbank, nach Klagenfurt zum Herkules-Kleinkunstpreis und zum Comoly-Preis in München. Gewonnen habe ich nie. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei komödiantische Kurzprogramme: „Feng Shui und der Ernst des Lebens“ und „Die Brautshow: eine Braut packt aus“. Ich wusste, dass es hilfreich sein kann, den einen oder anderen Preis zu gewinnen, um dadurch den Fuß auf renommierte Kabarettbühnen zu setzen, und so habe ich halt mein Glück versucht.
In Passau war ich an diesem Abend die einzige Frau auf der Bühne. Ich spielte als Vorletzte, und auf der Bühne fühlte sich so weit alles ganz gut an. Ich war jung, aufgeregt und hatte große Pläne für die Zukunft. Ich spielte mein Stück „Die Brautshow“ mit einer komödiantischen Figur namens „Tina Tiny“ mit britischem Akzent. Schräg und schrill. Die Geschichte war, dass ich meine Hochzeit und mein künftiges Eheleben komplett geplant und durchorganisiert hatte: mit Deko, Blumenarrangement, Gästeliste usw. Sogar ein Brautkleid hatte ich gekauft und während der Vorstellung selbstverständlich auch an. Der Kleiderkauf war der Hauptgrund, das Stück zu schreiben! Ha ha. Wann kann man schon mal Braut sein ohne den echten Stress mit der Heirat?
GERUCH
Im Verlauf des Stücks stellte sich heraus, dass mir nur noch eine klitzekleine Kleinigkeit fehlte: der passende Ehemann! Den habe ich mir dann im Publikum ausgesucht. Natürlich hatte ich Entscheidungsschwierigkeiten bei der tollen Auswahl, die ich vorfand. Entscheidend ist bei der Partnerwahl ja der weibliche GERUCHssinn, und so schnupperte ich mich durchs Publikum. Letztendlich fand ich einen, der nach Geld roch, und teilte ihm scherzhaft das Datum der Hochzeit mit.
Blöderweise hatte ich mir an dem Tag beim Wettbewerb einen Mann ausgesucht, der von der Presse war und, wie ich später erfahren sollte, nicht fand, dass ich die richtige Wahl war!
Jedenfalls spielte ich, das Publikum applaudierte, der Techniker kam und sagte, dass es lustig war und ich nun bereit für eine Zugabe sein sollte, falls ich gewinnen würde. Würde ich gewinnen? Ne, dachte ich und sollte Recht behalten. Nach mir spielten noch „Zärtlichkeiten mit Freunden“, und sie hatten, wie ich ihrer Website entnehmen konnte, bereits zahlreiche Preise gewonnen. Ihr Bühnenaufbau dauerte etwas länger, sie spielten als Letzte und konnten dann gleich alles stehen lassen und eine Zugabe spielen, weil sie, wie die Jury mitteilte, gewonnen hatten – den Vorentscheid in Passau. In einer anderen Stadt ging es für sie weiter.
Am Ende gab es Blumen für alle und dabei schon eine erste Verwirrung, weil das Jurymitglied allen Blumen überreichte, mir aber nicht. Ein Kollege schenkte mir dann gönnerhaft seinen Strauß, sagte „Ladies First“ und bekam dafür Applaus. Von irgendwoher kam doch noch ein Strauß, und so hatten wir alle einen. Das war für mich bereits der erste komische Moment. Danach kamen die Jurymitglieder und schütteln uns die Hände. Dabei würdigten sie mich keines Blickes, was mir schon bei der Begrüßung aufgefallen war: Da hatten sie die anderen herzlich begrüßt wie alte Bekannte und mich wie einen Fremdkörper. Ich bemerkte es, schenkte dem Moment aber nicht weiter Beachtung.
Als ich von der Bühne kam, eilte die Frau von der Hypovereinsbank (die das Preisgeld spendierte) zu mir, drückte mir die Hand und sagte, sie habe meinen Auftritt großartig gefunden und ich solle mir nichts dabei denken, was die anderen sagten. Ich war verwirrt. Ich dachte, ich sei von allen eingeladen worden. Ich hatte ja ein Video eingereicht und war (so hieß es in dem Schreiben) von der Jury ausgewählt worden. Aber wohl nur von ihr?
Ich spürte einen Stich im Bauch, und gleichzeitig freute ich mich über das Lob. Hatte nur sie mich auf der Bühne sehen wollen und mich vielleicht als einzige Frau durchgesetzt? Auch dieses Gefühl packte ich weg und meine Sachen zusammen. Ein Jurymitglied vom Scharfrichterhaus sagte, dass wir noch in eine Kneipe gehen; wer mitwolle, könne gerne mitkommen. Und so saßen wir zusammen, und die Kollegen waren alle nett. Wir redeten über dies und das. Plötzlich kam ein Mann vom Nebentisch und meinte, er verstehe nicht, warum nicht ich den Preis gewonnen hätte, das sei mal was Originelles gewesen. Das Jurymitglied erwiderte, seine Frau habe das auch gesagt und es hätte fast einen Ehestreit gegeben wegen mir. Er selber müsse erst mehr von mir sehen, er könne da noch nichts sagen, denn das sei ja nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Ich könne ihm ja meinen Tourplan zumailen. So was hatte ich aber gar nicht, es war ja erst mein vielleicht fünfter Auftritt mit dem Stück. Er erwähnte noch, der Herr von der Presse habe mit meinem Auftritt nichts anfangen können. Und so fand ich heraus, dass es dieser Herr war, den ich am Ende zum „Heiraten“ ausgewählt hatte. Vielleicht war er ja frisch geschieden und fand das deshalb gar nicht lustig. Wer weiß?
Ich spürte, dass mich der Verlauf des Abends ziemlich durcheinander brachte. Ich war aus Gründen, die ich selbst nicht verstand, „umstritten“. An meinem Auftritt schieden sich an diesem Abend die Geister. Einerseits war ich froh über das Schöne, was gesagt wurde, und gleichzeitig traurig, weil es sich unfair anfühlte, der Situation so ausgeliefert zu sein. Für mein Nervenkostüms war das alles zu viel. Mein Selbstwertgefühl war auch noch nicht ausgeprägt genug, um das einfach wegzustecken und sportlich zu sehen. Ich mochte den „Stallgeruch“ und den Umgang dort irgendwie nicht.
GLEICHGEWICHT
Als ich im Hotelzimmer war, weinte ich. Ich hatte mein inneres GLEICHGEWICHT verloren. Erst schluchzte ich ein bisschen, dann kullerten immer mehr und mehr Tränen aus mir heraus, und schließlich heulte ich wie ein Schlosshund. Am nächsten Tag reiste ich mit geröteten Augen ab. Ich war mit großer Erwartung gekommen und mit größerer Traurigkeit gegangen. Die Tiefe meiner Traurigkeit überraschte mich, und ich stellte fest: Dieser Wettbewerbsgesellschaft war ich nicht gewachsen.
Der Presseartikel zu meinem Auftritt fiel nicht gut aus: Mir war nicht mehr als ein Satz gewidmet. Ich weiß ihn heute noch auswendig. „Warum Kirstie Handel aus München mit ihrer ‚Brautshow‘ eingeladen war, weiß allein die Jury“ oder so ähnlich. Ein Satz, der mir einerseits durch Mark und Bein fuhr, den ich gleichzeitig auch ein bisschen lustig fand. Gnadenlos war er, dieser Satz, und absurd. Wie ein typischer bayerischer Wadlbeißer kläffte diese eine Zeile der Passauer Neuen Presse in mein Ohr. Die anderen wurden lobend erwähnt.
„Zärtlichkeiten mit Freunden“, stellten den Artikel gleich auf ihre Website. Ich empfand den Ausflug in diese Parallelwelt als seltsam, jedenfalls nicht freundlich, und zärtlich schon gar nicht. Wahrscheinlich war ich zu zart besaitet. Bin ich auch heute noch, aber ein bisschen anders. Ich habe jetzt mehr innere Autonomie. Das hilft.
Ich kann sehr traurig, aber dann auch schnell wieder sehr fröhlich sein. Damals hörte ich von einem Autor, der in den Umschlagtexten seiner Bücher nur schlechte Pressekritiken abdrucken ließ, und dachte mir, eines Tages veröffentliche ich diesen Satz auch. Heute ist es so weit. Ich tue es und schmunzle dabei.
Und ich bin natürlich trotzdem meinen Weg weiter gegangen, ein bisschen anders, nicht bei den großen Kabarettbühnen. Es gibt viele Künstler und Künstlerinnen aus jener Zeit, die den Weg über die Wettbewerbe gegangen und heute sehr erfolgreich sind. Ich selbst machte über die Jahre immer weniger Comedy und mehr mein mobiles Familientheater, wo ich mich, was die Strukturen und das Publikum betrifft, gleich zu Hause fühlte. Die Leute merkten das und fragten dann, ob ich hierhin oder dorthin kommen kann, und so führte eins zum anderen. Im Bereich Kinder- und Familientheater habe ich auch weniger das Gefühl, Komplizin einer kapitalistischen Verwertungslogik zu sein.
GESCHMACK
Heute denke ich: Ich habe damals keinen Preis gewonnen, aber wozu brauche ich den überhaupt? Ich bin doch da, wo ich gerne bin. Ich spiele einfach. Ich finde sowieso, man sollte Jurys abschaffen. Wozu braucht man die? Wieso sollen Menschen über andere Menschen Urteile fällen und überhaupt in einer Position sein, das zu tun? Wieso können nicht einfach die Leute selbst entscheiden, was ihnen gefällt und was nicht? Wozu diese Wettbewerbssituation? Und wer bestimmt, wer über andere bestimmt? Ich finde auch die Auswahl von Jurymitgliedern immer undurchsichtig.
In staatlichen Förderstrukturen wird oft mit „Qualität“ argumentiert, die es zu fördern gelte. Ich hatte mal im Kulturreferat München eine Diskussion dazu, als es um die Produktionsförderung für junges Publikum ging, für die wir (Verband der freien Kinder und Jugendtheater) uns damals einsetzten. Ich fragte: Wer kann denn entscheiden, was Qualität überhaupt ist? Es ist doch immer persönlicher GESCHMACK. Ihr Argument war, eine Jury wirke eben wie eine Qualitätskontrolle, weil es ja Steuergelder seien und eben nicht jedem eine Förderung zustehe.
Mein Eindruck ist hingegen, dass es bei Jurys Trends und viele Vorurteile gegenüber manchen Genres gibt. Es wird auch zu wenig beachtet, was das alles mit denen macht, die leer ausgehen. Letztendlich ist es eine Art Machtspiel. Man müsste zunächst mal allen Künstlern/Künstlerinnen die gleichen Startvoraussetzungen geben, Geld für Produktionen und Räume, und erst hinterher könnte man, wenn überhaupt, über „Qualität“ reden. Ich glaube, man wäre von den Ergebnissen ziemlich überrascht. Auch müsste man, wenn es um Kinder- und Jugendtheaterproduktionen geht, wohl eher die Kinder und Jugendlichen fragen, weil schließlich sie es sind, an die sich die Stücke richten. Aber so würde man halt die Kontrolle über die Kunstwelt verlieren, und das wollen die politischen Entscheidungsträger nicht.
Wie auch immer. In München gibt es seitdem einige Kollegen, die von dem Geld, das es seit damals für Kinder- und Jugendtheaterproduktionen gibt, profitieren. Meist kriegen jene, die einmal von einer Jury ausgewählt wurden, immer wieder Geld – wie auch damals beim Wettbewerb „Zärtlichkeiten mit Freunden“, die ja bereits vorher zahlreiche Preise erhalten hatten und nachher sicherlich auch.
Preise ziehen Preise an. Geld zieht noch mehr Geld an, Förderungen mehr Förderungen. Früher gab es in München für Kinder und Jugendliche nichts. Da waren alle gleich arm. Jetzt gibt es halt zwei Klassen. In Augsburg, wo ich seit 2013 wohne, ist das ein wenig anders, da gibt es viel weniger Geld, aber zumindest bei Projektförderungen mehr Möglichkeiten für alle.
So oder so – letztendlich gehen alle ihren Weg. Jeder auf seine Weise. Die einen in der Mitte auf dem Königsweg, mit Erfolg gekrönt und Jury-Qualitätssiegel samt Preisen oder Produktionsgeld. Nicht vergessen sollte man aber den Preis, den der Preis eben auch hat. Man steht unter dem Druck, der Qualitätskontrolle gerecht zu werden, und erntet dafür die Freude über den Preis und die Anerkennung. Vermutlich erzeugt auch das einen gewissen Konformitätsdruck. Tiefergehende Systemkritik hört man von institutionell oder mit höheren Summen geförderten Kulturschaffenden eher selten. Warum eigentlich nicht, Preise sind doch kein Schweigegeld? Aber das ist ja meistens so bei Menschen, die Teil des Systems geworden sind und davon profitieren.
Die anderen stehen am Rand. Und ich kann mittlerweile sagen, der Platz am Rand ist gar nicht so schlecht. Von da aus sieht man gut, und eine gewisse Narrenfreiheit gibt’s gratis dazu. Man muss auch keine Sorge haben, unter dem schweren Gewicht der ganzen Orden und Auszeichnungen, die einem um den Hals gehängt werden, umzufallen. Wie praktisch! Und ich kann mich genüsslich dem künstlerischen Lustprinzip hingeben: Wenn ich Lust habe, schreibe ich. Gerne würde ich auch sagen, wenn ich Lust habe, produziere ich. Aber ich gebe zu: Es ist schon nicht ganz einfach, ohne große Mittel zu produzieren, deshalb habe ich mich damals ja auch für das Geld eingesetzt.
Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt hilft allen dabei, die Jurys des Lebens, den Geschmack der Jurys des Lebens, und dem Geschmäckle der Jurys des Lebens sowie den Stallgeruch der Jurys des Lebens zu durchschauen und nicht ganz so ernst zu nehmen: der HUMOR. Ist das der siebte Sinn?
TIEFENSINN
Und sogleich meldet sich meine Jury im Kopf zu Wort: Der siebte Sinn sei nicht der Humor, sondern der Tiefensinn. Die Eigenwahrnehmung des Körpers. Die Wahrnehmung bestimmter Reize aus dem Körperinneren. Vielleicht entspringt aus diesen gedanklichen Seelentiefen ja mein Text.
Aber jetzt höre ich lieber auf zu schreiben, denn wenn ich jetzt noch tiefer in die Materie des Tiefensinns einsteige – samt Frontallappen und Stirnhirn – wird das noch fürchterlich verkopft – fast wie eine Jurybegründung. Ha ha.